Lehren und Lernen trotz KI
Nutzen und Hürden
Der methodische Einsatz von künstlicher Intelligenz im Schulalltag ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Laut einer repräsentativen Umfrage der Vodafone Stiftung Deutschland sehen 57 Prozent der Befragten den Einsatz von KI in der Schule als gefährlich an. Gleichzeitig wünschen sich viele, dass KI Teil des Lehrplans wird. Die Studie stammt vom April 2023. Seitdem hat sich viel getan. Viele Lehrkräfte kennen sich besser aus, Schülerinnen und Schüler können KI-Tools bedienen. Doch es bleiben noch viele ungeklärte Fragen. Hier sind einige Chancen, Herausforderungen und Nachteile von KI-Tools aufgelistet:
| Vorteile | Nachteile/Herausforderungen |
| Größerer Lernerfolg durch die automatisierte Diagnose und individuelle Förderung (für ITS) | Wenige belastbare Studien zu Lernwirksamkeit (abgesehen von ITS) |
| Insbesondere Tools, die Diagnosen liefern und Lernpfade verfolgen, können in Zukunft weiterführende Einblicke ins Lernen ermöglichen. | Befürchtung, dass Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit verlieren zu recherchieren, Quellen kritisch zu bewerten, oder Texte selbst zu schreiben. |
| Stärkung der Bildungsgerechtigkeit und Verringerung der Chancenungleichheit, weil KI prinzipiell für alle zugänglich gemacht werden kann, unabhängig von sozialer Herkunft. | Wachsende Ungleichheit, weil motivierte und starke Schülerinnen und Schüler (mit finanziellen Ressourcen für den Zugang zu KI-Tools) diese Tools effektiver nutzen können. |
| Zeitersparnis für Lehrkräfte durch effiziente Übernahme von Aufgaben in der Unterrichtsvorbereitung, -durchführung oder -nachbereitung | Anfänglicher Mehraufwand, weil didaktische Konzepte unausgereift sind oder fehlen. |
| KI-Tools können genutzt werden, um dem Lehrkräftemangel zu begegnen. | Unzureichende Fähigkeiten im Umgang mit KI-Tool führen zu Abhängigkeiten von der Technik, ineffizientem Einsatz und falschem/fehlendem Verständnis der Risiken. |
| Vorteile für adaptives, inklusives Unterrichten durch die individuellere Ansprache als auch Überwindung von Hürden für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen | Teilweise unzureichender Datenschutz |
Tabelle: Auflistung von Vor- und Nachteilen, die durch KI-Technologie in der Schule entstehen (können). Zusammenfassung von Punkten, die im Forum Verlag und auf dem Deutschen Schulportal genannt wurden.
Einige der Aspekte sollen im Folgenden genauer betrachtet werden.
Macht KI Lernende dumm?
Eine häufig genannte Befürchtung beim Einsatz von KI im Schulkontext ist, dass Schülerinnen und Schüler durch deren häufige Verwendung elementare Fähigkeiten nicht mehr erlernen oder diese nicht ausreichend trainieren. KI-Anwendungen können allerdings durchaus einen Nutzen für Lernprozesse haben. Studien haben gezeigt, dass durch die Verwendung von Intelligenten Tutorensystemen Leistung und Motivation steigen. In der Zukunft ist auch denkbar, dass Lernprozesse besser verstanden und unterstützt werden können, insbesondere mit Tools, die den Lernstand analysieren.
Wie sieht es jedoch mit der aktiven Verwendung von KI-Tools aus?
Verlernen von Kompetenzen
Mit der Einführung neuer Technologien besteht stets die Gefahr, dass bestimmte Fähigkeiten verloren gehen, da diese von der Technik übernommen werden. Ein prominentes Beispiel ist der Taschenrechner: Schon bei seiner Einführung wurde kontrovers diskutiert, ob Lernende grundlegende Fähigkeiten wie das Kopfrechnen verlernen könnten. Kritiker warnten davor, dass durch die Abhängigkeit von solchen Hilfsmitteln ein Kompetenzabbau stattfinden könnte – ein Prozess, der heute auch im Zusammenhang mit KI-Tools befürchtet wird.
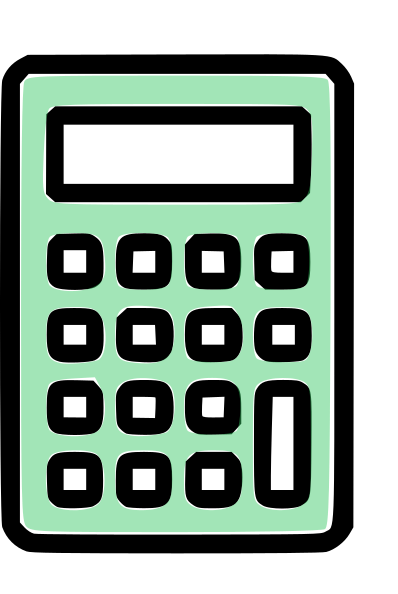
Taschenrechner, kolorierte Zeichnung von DALL-E 3 Zeichne mir einen Taschenrechner
(28.3.2025), gemeinfrei
Werden Lernprozesse verkürzt oder ganz umgangen, bezeichnet man das als Skill-Skipping. Diese Automatisierung grundlegender Fähigkeiten kann langfristig zu Deskilling, also einem umfassenden Verlust von Kompetenzen, führen. Lernende stellen sich inzwischen Fragen wie: „Warum sollte ich noch Texte schreiben, wenn ChatGPT das eleganter und fehlerfrei erledigt? Warum für das Abitur lernen, wenn ChatGPT die Prüfungsfragen lösen kann?“ (mehr dazu gibt es auf der Seite des BR zu lesen). Oder: „Warum Sprachen erlernen, wenn KI-Tools eine direkte und präzise Übersetzung in jede beliebige Sprache ermöglichen?“
Diese Entwicklungen werfen zentrale Fragen auf, mit denen sich Lehrende auseinandersetzen müssen:
- Welche Fähigkeiten und welches Wissen brauchen junge Menschen in der Zukunft - und welche nicht mehr?
- Wie kann man Deskilling/Skill-Skipping vermeiden?
- Wie kann die Motivation gestärkt werden, um diese Fähigkeiten und dieses Wissen zu erwerben?
Dazu hat Beat Dübeli-Honegger eine Grafik zur Selbstreflexion erstellt, um auch mit Lernenden diese Fragen zu durchdenken. Diese ist hier zu finden.
Ein wichtiger Ansatz zur Vermeidung von Deskilling besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler grundlegende Kompetenzen und ein breites Wissen erwerben, um KI-generiertes Material kritisch bewerten und sinnvoll einsetzen zu können. Die Unabhängigkeit von technologischen Hilfsmitteln bleibt dabei essenziell, um langfristige Autonomie zu gewährleisten. Patrick Bronner hebt hier hervor, wie bedeutend es ist, dass das Lernen selbst als bereichernde Erfahrung wahrgenommen wird.
- Das Erleben von Kompetenz und die Freude am Lernen.
- Die soziale Eingebundenheit in eine Gemeinschaft von Lernenden.
- Die Entwicklung von Autonomie und Selbstbestimmung – frei von einer Abhängigkeit von Maschinen.
Diese Überlegungen bieten eine Grundlage, um die Rolle von Technologie in der Bildung neu zu definieren und den Lernprozess bewusst zu gestalten. Be a learner, not a finisher“ könnte ein Motto dafür sein. Florian Nuxoll schlägt vor, im Unterricht bewusst Phasen mit und ohne digitale Endgeräte einzuführen. So können sich die Lernenden einerseits auf Lernprozesse ohne KI-Unterstützung konzentrieren, aber ebenso Vorteile von Lernen mit und über KI nutzen. Allerdings ist absehbar, dass manche Fähigkeiten in einer Welt mit KI-Tools langfristig an Bedeutung verlieren.
Erlernen von neuen Kompetenzen
Dem Gegenüber stehen jedoch auch eine Vielzahl an neuen Fähigkeiten, die wir durch technologische Tools erlernen, sogenanntes Upskilling. Zum Beispiel können ohne tiefgehende Vorkenntnisse im Bereich Grafikdesign mit ansprechende Bilder mit KI-Tools erstellt werden. Diese Technologien helfen, neue Fähigkeiten zu erwerben und vorhandene Fertigkeiten auf ein höheres Niveau zu bringen.
Digitale Ungleichheit
Bei der Nutzung von ITS (Intelligent Tutoring Systems) zeigt sich deutlich, dass alle Schülerinnen und Schüler Fortschritte erzielen, jedoch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler überproportional profitieren. Sprachmodelle wie generative KI bieten ebenfalls überwiegend denjenigen Lernenden Vorteile, die über hohe Selbstreflexion, fundiertes inhaltliches Wissen und ausgeprägte kognitive Fähigkeiten verfügen. Um diese Tools effektiv zu nutzen und hochwertige Ergebnisse zu erzielen, ist die Fähigkeit, präzise und durchdachte Prompts zu formulieren, entscheidend. Dies setzt ein hohes kognitives Niveau voraus und führt dazu, dass die Kluft zwischen Lernenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen noch größer wird. Außerdem haben nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen Zugang zu Technologien wie generativen KI-Tools, sei es aufgrund finanzieller, technischer oder infrastruktureller Hürden. Dies kann die bereits bestehende Schere zwischen privilegierten und weniger privilegierten Lernenden weiter verstärken. Um dieser Herausforderung zu begegnen, müssen Bildungssysteme sowohl den Zugang zu Technologien als auch die Förderung der notwendigen Kompetenzen für deren Nutzung sicherstellen. Das ist auch ein Thema in der Handlungsempfehlung der Kultusminister-Konferenz zu KI in der schulischen Bildung.
Auf der anderen Seite können KI-Tools als Trainer oder zur Verbesserung von Texten auch die Schülerinnen und Schülern unterstützten, die keine inhaltliche Unterstützung durch Nachhilfelehrer oder Eltern erfahren. Hier können KI-Tools auch zur Demokratisierung von Wissen und Fähigkeiten führen.
Sind die Schülerdaten sicher?
Manche KI-Anwendungen sind datenschutzkonform, die meisten aber nicht. Anwendungen, die entweder lokal laufen oder vom Land oder der Schule zur Nutzung genehmigt wurden, können genutzt werden. Noch wichtiger als das jeweilige Tool ist jedoch auch die Art der Verwendung. Einige Nutzeroberflächen und Anwendungen, wie fAIrChat und Fobizz nutzen Schnittstellen zu Open AIs ChatGPT. Somit können Anfragen nicht direkt einer Schule oder sogar einer Person zugeordnet werden. Teilen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte jedoch persönliche Daten über diese Anwendungen, dann landen die Informationen auch auf den amerikanischen Servern. Deshalb ist es wichtig, alle Nutzende darauf hinzuweisen, dass keine persönlichen Daten preisgegeben werden dürfen. Weiteres ist auf der Seite KI frisst Daten
zu lesen.
Wem gehören die Hausaufgaben?
Urheberrechte
Einerseits werden für das Training von generativen Tools Daten genutzt, die urheberrechtlich geschützt sind. Andererseits unterliegen Produkte, die mit KI-Tools entstehen, keiner Urheberschaft. Die Bilder oder Texte sind somit nicht urheberrechtlich geschützt, sondern gemeinfrei. Sie können diese nutzen, aber alle anderen auch. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine starke Ähnlichkeit (auch keine zufällige) mit einem existierenden, urheberrechtlich geschütztem Produkt oder Werk vorliegt. Außerdem können bei KI-generierten Gesichtern Ähnlichkeiten mit realen Menschen existieren, wodurch deren Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Deshalb sollte bei jedem KI-generierten Produkt, insbesondere bei Bildern von Menschen, genau geprüft werden, ob diese weiter genutzt werden dürfen. Urheberrechtlich können solche Produkte nur dann geschützt werden, wenn eine persönliche geistige Schöpfung vorliegt. Das bedeutet, dass Elemente des KI-generierten Produkts von Ihnen angepasst wurden. Die Lizenzbedingungen des verwendeten KI-Programms geben weitere Auskunft, wie und in welchem Umfang die generierten Produkte weiter verwendet werden dürfen.
KI-generierte Texte überprüfen
Wenn Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben abgeben und diese ungewöhnlich ausführlich oder fehlerlos geschrieben sind, fragen sich Lehrkräfte häufig, ob eine KI genutzt wurde und ob sich dies nachweisen lässt. Bisher gibt es keine rechtssichere Überprüfung, auch wenn unterschiedliche Programme einen Plagiatscheck anbieten und möglicherweise auch gute Trefferquoten liefern. Für eine Leistungsbewertung dürfen diese nicht verwendet werden. Einen kurzen Überblick dazu gibt das FAQ des ZSL.
Sind Hausaufgaben sinnlos?
Lehren und Lernen, kolorierte Zeichnung von DALL-E 3 Zeichne ein Clipart von einem Kind und einem Erwachsenen, die lernen.
(28.3.2025), gemeinfrei
Bereits vor der Veröffentlichung von ChatGPT und der Entwicklung und Verbreitung von unzähligen KI-Tools wurden Hausaufgaben nicht allein vom Schüler oder der Schülerin selbständig bearbeitet. Eltern oder Nachhilfe-Lehrer unterstützen häufig dabei, sei es bei Hilfestellungen für das Lösen von Aufgaben oder bei der Korrektur von Texten. Doch der Einsatz von KI-Tools verstärkt die Frage, ob Hausaufgaben sinnvoll sind, insbesondere bei Aufgabentypen, die schnell und mühelos von einer KI gelöst werden können (wie z.B. das Verfassen von Texten).
Fazit
Die Auswirkungen von KI-Tools auf das Lehren und Lernen sind weitreichend. Trotz dieser Technologie bleibt das Lehren und Lernen ohne KI jedoch ein wichtiger Teil des Unterrichts.
Weitere interessante Artikel finden sich auf LEHRER NEWS, der Tagesschau oder dem deutschen Schulportal.